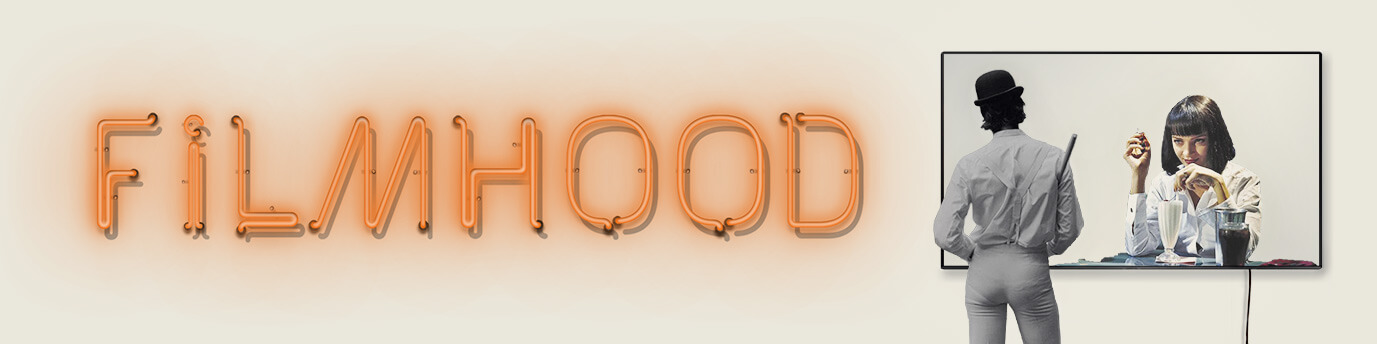Erstaunlich ist, dass der Film Louder than Bombs seinem Titel und all der erzählten Tragik zum Trotz leise inszeniert ist. Die Geschichte um den Selbstmord einer depressiven Kriegsfotografin, dreht sich nicht um die Geschichte der Frau selbst, die sich weder bei ihrer Familie noch bei ihren Arbeitseinsätzen zu Hause fühlt, auch wenn diese Geschichte alle anderen zusammenhält. Nein, es werden vielmehr drei andere Geschichte erzählt: Alle drei handeln davon wie ihr Mann und ihre beiden ungleichen Söhne ohne die wichtigste Frau in ihrem Leben zurechtkommen und mit welchen Problemen sie sich herumschlagen.

Vater und Söhne
Dabei beschwört die Stille der Inszenierung etwas Poetisches herauf. Der Unfall der Mutter wird in dem Gedanken des Sohnes zu einem bittersüßen Gedicht. Der Regisseur Joachim Trier filmt die Geschichten des Vaters und der Söhne so wie ein Romancier sie beschreiben würde: Einfühlsam, poetisch und aus Sicht der jeweiligen Person. Mit dem Blick der verschiedenen Personen wechselt er seine filmischen Mittel. Wie verschiedene Figuren sich im gelesenen Monolog unterschiedlich mitteilen, so teilen sich auch hier die verschiedenen Protagonisten durch unterschiedliche filmische Mittel mit. Das geschieht unauffällig, aber doch spürbar, wie man eine Feder auf die Haut fallen spürt. So werden kleine Gesten groß und kurze Blicke länger, oder genauer gesagt: bedeutsam. Am eindrucksvollsten sind kurze, mit Voice-Over untermalte Schnitt-Montagen, die den Bewusstseinseinstrom des Protagonisten sichtbar und noch wichtiger (nach-)fühlbar machen.
Vorheriger Beitrag
Nächster Beitrag